Isabel ist seit 2010 Hebamme und arbeitet geburtshilflich in einer kleiner Klinik. Hier erzählt sie von der Geburt ihrer ersten beiden Kinder, die in der 26. Schwangerschaftswoche und damit viel zu früh geboren wurden. Ihren ersten Sohn Jonathan musste sie nach wenigen Tagen wieder gehen lassen. Sein Zwillingsbruder David musste nach der Geburt noch über drei Monate zusammen mit Isabel in der Kinderklinik bleiben. Heute ist er vier Jahre alt und hat seit 2013 einen kleinen Bruder bekommen.
Ich bin Hebamme. So richtig, mit allem was ich bin und habe. Mit Leib und Seele. Und in den Stürmen, die unseren Beruf politisch gesehen grade so durchschütteln und in so manchen Diensten, in denen ich statt Geburtshilfe zu leisten nur das Schlimmste verhindern kann, da gilt ein Zitat von Paulo Coehlo: „Du musst mit ganzem Herzen an dem Platz sein, den du dir gewählt hast. Ein geteiltes Reich kann den Angriffen des Feindes nicht widerstehen. Ein geteilter Mensch kann dem Leben nicht in Würde begegnen.“ (Am Ufer des Rio Pietro saß ich und weinte). Ich arbeite in einer kleinen Klinik im Südwesten von Deutschland mit knapp 600 Geburten. Die Geburtshilfe ist meine große Liebe, ich möchte nichts anderes tun.
Ich war 24 Jahre alt, frisch aus Österreich zurück mit dem abgeschlossenen Hebammenstudium in der Tasche und hatte gleich die erste Stelle in einer Klinik gefunden. Im Oktober 2010 startete ich also ins Berufsleben. Als Startgeschenk sozusagen, gab es die große Liebe gleich dazu. Ich sah ihn und wusste: der oder keiner! Im Januar zogen wir zusammen, Mitte März wollten wir ein Kind, Anfang April wurde ich schwanger. Klappt ja schon mal hervorragend.
Ende April bemerkte ich beim Toilettengang im Nachtdienst, dass ich blutete. Da aber meine Schwangerschaft noch geheim bleiben sollte, verriet ich nichts und harrte bis zum Dienstende aus. Am nächsten Morgen ging ich ohne geschlafen zu haben mit Nick zum Ultraschall, um zu sehen, was das zu bedeuten hatte. Wir waren traurig und zeitgleich froh: Ich war mit zweieiigen Zwillingen schwanger, aber einer der beiden Embryos hatte wohl nicht bleiben können. Es waren zwei getrennte Fruchthöhlen sichtbar, eine leer, in der anderen bubberte ein Herzchen. Ich war erstmal froh, doch noch schwanger zu sein. Die Blutungen versiegten und ich konnte mich weiterhin freuen.
Ende Mai war ich in der 12. Schwangerschaftswoche und wir wollten nun doch nochmal nachschauen lassen, dass mit dem zweiten Kind alles in Ordnung war. Beim Ultraschall klappte mir dann der Mund auf: Zwei Kinder strampelten in meinem Bauch. Diagnose: Zwillingsschwangerschaft, eineiig. Mir waren zwei Dinge sofort klar: Oh mein Gott! Und: Es waren zu Beginn sogar drei Kinder: eineiige Zwillinge und ein drittes dazu. Nun freuten wir uns also doch wieder über Zwillinge. Ich werde nie vergessen, wie Nick noch in der Arztpraxis unbedingt seine Eltern anrufen musste. Von der Schwangerschaft wussten sie bereits. Am Telefon hörte ich ihn sagen: „Herzlichen Glückwunsch, ihr werdet doppelt Großeltern!“. Dann hörte ich lange nichts. Es hatte seinem Vater schlicht die Sprache verschlagen: „Papa, bist du noch dran?
Irgendwas stimmt da nicht
In der 14. Schwangerschaftswoche wieder: Blutungen… wieder Ultraschall. So hatte ich mir das nicht vorgestellt und mir dämmerte: Irgendwas stimmt da nicht. Die Kinder wuchsen unterschiedlich schnell und schon jetzt war klar, dass das irgendwann ein Problem werden würde. Es fiel die Verdachtsdiagnose FFTS (Anm. d. Red.: Fetofetales Transfusionssyndrom; Erkrankung, die den Blutfluss und damit das Wachstum von Zwillingen beeinträchtigt). Seltsam, irgendwie war ich immer noch ganz ruhig – konnte alles gar nicht sein. Doch nicht bei mir!
Trotzdem fuhren wir nach Hamburg zu Dr. Hecher, dem Spezialisten für FFTS-Schwangerschaften. Er schloss ein FFTS aus und hatte leider noch unglücklichere Nachrichten: Selektive IUGR (Anm. d. Red.: Intrauterine Wachstumsstörung, bei der das Wachstum des Babys zu gering ist) des zweiten Zwillings. Ein FFTS kann man behandeln, eine Unterversorgung nicht. Ich werde dieses Gesicht nie vergessen, als er sagte: „Stellen Sie sich darauf ein, zwei Frühchen zu bekommen.“ Ich sah ihn an: „Die 30. Schwangerschaftswoche schaffen wir, oder?“. Er zog die Augenbrauen hoch: „Vielleicht.“
Sein „vielleicht“ hallte in meinem Kopf die gesamten 600 Kilometer bis nach Hause nach. Bis zur 19. Schwangerschaftswoche verbrachte ich die Zeit mit Recherchen. Ich forderte vom Bundesverband Das frühgeborene Kind e.V. sämtliche QM–Zahlen (Anm. d. Red.: Statistiken bezügliches des Qualitätsmanagements) der umliegenden Unikliniken an. Denn eines war klar: Keinesfalls geht es in die nächste städtische Klinik. Ich saß mit zwei Kindern im Bauch und dem Textmarker in der Hand am Schreibtisch und markierte die Outcome-Zahlen (Anm. d. Red.: Zahlen, wie viele Frühgeborene lebend und gesund entlassen werden) der unterschiedlichen Kliniken in den einzelnen Wochen: Hirnblutungen, Todesfälle, schwer behindert, leicht behindert, gesund.
Ich rechnete und verglich und entschied: Heidelberg. Der Ort an den ich NIE MEHR ZURÜCK wollte; hatte ich doch dort 2006 den ersten Versuch einer Hebammenausbildung abgebrochen. Egal! Die FIPS (Frühgeborenen Intensivpflegestation) hatte sehr gute Ergebnisse – sofern man davon sprechen kann. Also jedenfalls waren sie unter den besseren schlechten Ergebnissen.
Jeden Tag Hoffnung, Angst, Warten…
In den nächsten Wochen musste ich regelmäßig zu Ultraschall- und Dopplerkontrollen zum Arzt. Die Werte schwankten, wurden aber insgesamt zusehends schlechter.
In der 23+1 Schwangerschaftswoche dann ein erneuter Ultraschalltermin mit dem Befund Reverse-flow in der Ateria uterina (Anm. d. Red.: Befund bei der Doppler-Ultraschalluntersuchung, der anzeigt, dass die Placenta nicht ausreichend arbeitet) des zweiten Zwillings. Ich sehe auf dem Monitor sofort die verräterischen Bogen nach unten im Doppler und mir schießen die Tränen in die Augen, noch bevor der Gynäkologe etwas sagen kann. Ich weiß, was das bedeutet. Die von meinen Tränen völlig verdutzte Arzthelferin versteht nur Bahnhof, als der Arzt mich ansieht und fragt: „In welche Klinik wollen Sie?“. Ich hocke im Wartezimmer, während er nochmal mit Professor Hecher in Hamburg telefoniert, um sich eine Zweitmeinung zu holen. Ich sitze da, schluchzte und rufe Nick von der Arbeit her. Es ist einfach viel zu fu**ing früh, um über eine Geburt nachzudenken.
Wir fahren nach Heidelberg, ich werde aufgenommen. Der Kinderarzt kommt von der Frühchenintensiv und bespricht den Plan: So lange rauszögern, wie es geht. Falls das nicht geht, möchte er unsere Wünsche hören: Wollen wir eine Versorgung für unsere Kinder? Dürfen sie (friedlich) sterben und wird nur eine Schmerzbegleitung geben? Wir hören Prozentzahlen, Wahrscheinlichkeiten für Behinderungen, Tod… das volle Programm. Es ist wie in einer Wattewolke, ich nehme das gar nicht wahr. Wir sitzen da und können das nicht glauben. Immer noch nicht. Ich bekomme die erste Lungenreife (Anm. d. Red.: Kortisongabe, die bewirken soll, dass die Lunge schneller reift) und beziehe mein Zimmer.
Die nächsten Tage bestehen aus Warten. Jeden Tag CTG, je nach Befund jeden Tag oder jeden zweiten Tag Dopplerkontrollen. Und mit mir im Zimmer: Eine hysterische Schwangere in der 35+5 Schwangerschaftswoche, die mich ständig mit Fragen nach der Überlebenswahrscheinlichkeit nervt und der überflüssigen Frage, ob sie Zimtsterne essen darf. Ich kann nicht glauben, wie taktlos man sein kann. Die zweite ist ebenfalls irgendwo rund um die 33. Schwangerschaftswoche, aber völlig anders: Blasensprung seit der 19. Schwangerschaftswoche; seitdem hat sie Bettruhe. Ich schlucke.
Tag eins, zwei, drei… fünf… zehn. Die Werte sind nicht berauschend, das Wachstum des zweiten Kindes auch nicht. Jeden Tag schwebt das Damoklesschwert bzw. das Skalpell über mir. Jeden Tag Hoffnung, jeden Tag Angst, jeden Tag Warten.
14 Wochen und einen Tag zu früh!
25+4 Schwangerschaftswoche: Es ist morgens sieben Uhr und als ich die Augen aufschlage, steht eine ganze Gruppe Menschen um mich rum. Die einen wollen mir Frühstück bringen, die anderen wollen mich zur Dopplerkontrolle schicken. Ich schnappe die Akte und gehe zum Ultraschall. Und da ist es wieder: Reverse flow, das zweite Kind ist nicht gewachsen. Das anschließende CTG ist schlecht, das Kind dippt bis auf 80 runter (Anm. d. Red.: Herzfrequenz des Fetus, die normalerweise zwischen 115 und 160 Schlägen pro Minute liegt). Mir geht die Muffe. Die Oberärztin kommt und sagt mir, dass sie die Kinder holen will. Heute noch. Ich fühle gar nichts mehr, aber ich funktioniere. Nehme das Telefon und als Nick abhebt, sage ich nur ein Wort: „Heute!“ Er antwortet: „Ich komme!“ Es ist der 15. September 2011, der errechnete Termin ist der 25. Dezember 2011. 14 Wochen und einen Tag zu früh!
Gegen 12 Uhr Uhr komme ich in den Kreißsaal, gegen 12.30 Uhr fahren wir in den OP. Ich kenne das alles aus meinem Berufsalltag, aber ich fühle noch immer nicht, ich funktioniere. Der Anästhesist setzt die Spinale (Anm. d. Red.: Regionale, rückenmarksnahe Betäubung), dann liege ich auf dem OP-Tisch. Dass sie bereits angefangen, merke ich erst, als ich versengtes Fleisch rieche.
13.00 Uhr: Jonathan – unser Erstgeborener quäkt ganz sachte in die Welt. Ich darf ihn nicht sehen, er wird sofort zu den Kinderärzten gebracht und erstversorgt.
13.01 Uhr: David – unser kleinerer zweiter Junge ist da. Auch ihn bekomme ich nicht zu sehen.
Gegen 14 Uhr hält mich nichts mehr: Ich will zu meinen Kindern. Und lasse mich im Rollstuhl auf die Intensivstation bringen. Jonathan: 32 Zentimeter, 800 Gramm. David: 29 Zentimeter, 580 Gramm. Zwei Winzlinge liegen da in den Brutkästen: Sie sind intubiert, eine Nasensonde liegt, Elektroden kontrollieren Herz- und Atemfrequenz, ein Sensor am Fuß misst die Sauerstoffsättigung. Ich darf meine Söhne anfassen, berühren. Meine! Wir freuen uns in all dem Chaos, zwischen all den Sorgen. Die frische Bauchnarbe schmerzt, ich muss bald zurück ins Bett.
Am Nachmittag kommt meine Freundin (ebenfalls Hebamme) und streicht mir das Kolostrum (Anm. d. Red.: die erste Muttermilch, die besonders viele Abwehrstoffe enthält) aus der Brust. 20 Milliliter, das ist beachtlich, dafür dass die Geburt gerade drei Stunden her ist. Am Nachmittag sind wir nochmal bei den Jungs, dann bin ich erschöpft und will nur noch schlafen.
Ich ahne Schlimmes
Gegen 21 Uhr werde ich auf die Station gerufen. Ich weiß, wenn man gerufen wird, ist das kein gutes Zeichen. Die Kinderärztin spricht mit mir. Jonathan geht es sehr schlecht, sein Herz arbeitet nicht richtig, sie wissen nicht warum. „Kann er sterben?“, frage ich. „Ich kann das nicht verneinen; es kann passieren.“ Ich höre nur ein Rauschen, ich bin wieder in dieser Wattewolke. David geht es „den Umständen entsprechend“. Ich rufe Nick an, er ist noch auf der Autobahn und dreht sofort um. Wir verbringen die Nacht im Kreißsaal, der ist näher an der Intensivstation als die Station, auf der ich liege. Nick bekommt ein Bett. Ich bin unendlich dankbar, dass er hier sein darf.
Am nächsten Morgen ist Kinderarztvisite auf der Frühchenintensivstation. Jonathan hat eine Hirnblutung. Grad I rechts, Grad II links. Nicht toll, aber noch keine Katastrophe. Man kann das überleben, wenn es aufhört zu bluten. Wir beten, wir sitzen da einen ganzen Tag – die Zeit frisst sich selbst auf. Sie fragen uns, ob wir unsere Kinder taufen lassen möchten. Ich ahne Schlimmes. Zwischendrin gehe ich Milch abpumpen. Ich habe massenhaft davon.
17. September 2016, zirka 9 Uhr. Die Nacht ist ruhig, Nick schläft zu Hause, ich auf Station. Für den Morgen ist eine Kontrolle von Jonathans Blutung geplant. Als ich auf Station komme, bitten sie mich, Nick dazu zu rufen. Als er kommt, erwarten uns Kinderarzt, Oberarzt, Chefarzt, Kinderkrankenschwester. Sie schließen die Tür hinter uns. Jonathans Blutung hat sich massiv verschlechtert; er hat eine PVL (Anm. d. Red.: Periventrikuläre Leukomalazie; durch erheblichen Sauerstoffmangel verursachte Schädigung der weißen Substanz im Gehirn), sein ganzer kleiner Kopf ist voller Blut. Er ist völlig aufgeschwemmt, scheidet nicht mehr aus. Seine Leber, seine Nieren funktionieren nicht mehr, er krampft, hat epileptische Anfälle. Er kann es nicht schaffen, Jonathan liegt im Sterben. Dann bestehe ich nur noch aus Tränen. Es schwemmt mich davon. Wir organisieren eine Nottaufe, informieren die Paten, unsere Eltern.
Ich kann nicht mehr
11.30 Uhr: Unsere Kinder werden von dem Pfarrer, der auch mich schon getauft hat, getauft. Die Taufkleider haben wir auf den Inkubator gelegt, eine Kerze dürfen wir auf Station nicht anzünden.
12 Uhr: Nicht einmal ganz 48 Stunden nach seiner Geburt bekomme ich mein Kind zum Sterben in den Arm. Ich bitte darum, den Tubus erst zu ziehen, wenn er bei mir ist. Wir verabschieden uns von unserem Sohn, den ich nicht ganz 48 Stunde zuvor geboren habe. Ich bestehe aus Schmerzen, Tränen und einem gebrochenen Herzen – mehr ist nicht übrig von mir. Am Nachmittag schlafen wir völlig erschöpft auf meinem Bett ein. Ich kann nicht mehr…
David übersteht die folgenden Tage frühchenentsprechend gut. Keine Hirnblutung, keine schwerwiegenden Komplikationen. Er atmet ab Tag drei gegen die Beatmung an. An Tag sechs wird er extubiert und atmet ab da nur noch mit dem CPAP (Anm. d. Red.: Form der Atemhilfe (keine Beatmung) mit gleichbleibendem Luftstrom). Mein Leben besteht aus Pumpen und dem Sitzen neben dem Brutkasten. Ich zähle die Sättigungsabfälle und Atemaussetzer.
Eine Woche nach der Geburt und nicht mal ein Jahr nach unserem Kennenlernen stehe ich mit Nick am Grab unseres gemeinsamen Kindes. Wir beerdigen Jonathan, lassen Ballons in den strahlend schönen Septemberhimmel steigen, beten für David und lösen uns auf im Schmerz. Danach pumpe ich Milch ab und fahre den 45-minütigen Weg zu David. Ich mutiere zum Roboter.
Tag Zehn, Intensivstation: Ich darf mit David kuscheln. Bekomme ihn auf die Brust und spüre ihn kaum, so leicht ist er. Er hat auf 500 Gramm abgenommen. Er ist quasi gar nicht da. Trotzdem freue ich mich, fühle mich fast wieder ein wenig schwanger. Ich bin jeden Tag da. Jeden Tag insgesamt 90 Minuten Fahrt, jeden Tag zwischen Pumpen und heilender Narbe, Autobahn und Intensivstation.
Tag 17: David hat eine Sepsis (Anm. d. Red.: komplexe Entzündungsreaktion des Körpers auf eine Infektion; umgangssprachlich „Blutvergiftung“). Er schafft das Atmen nicht mehr alleine, wird reintubiert und wieder voll beatmet; bekommt Antibiose. Er hat dauernd Sättigungsabfälle und Atemaussetzer, die Herzfrequenz wird immer wieder langsamer. Wir warten und hoffen.
Tag 18: Wir warten und hoffen noch immer, es geht ihm schrecklich schlecht.
Tag 19: Wir warten und hoffen. David kämpft.
Tag 20: Entwarnung, der CRP (Anm. d. Red: unspezifischer Blutwert, der bei entzündlichen Erkrankungen ansteigt), sinkt. Es geht ihm langsam besser, er beginnt wieder selbst zu atmen. Wir atmen ganz leise mit.
Ich sage ja
David verbringt mit mir drei Monate und einen Tag im Krankenhaus. Ich bin jeden Tag bei ihm. Nach sieben Wochen wird er von der Intensivstation auf die Frühchenstation verlegt. Es ist ein täglicher Kampf. Ich bin bald bei allen Ärzten verhasst, weil ich trotz allem meine Vorstellungen durchsetze – es ist mir egal, ob ich sie nerve. Am 9. November 2016 kuscheln wir das allererste Mal als Familie gemeinsam im Klinikbett. Nick, unser kleiner Sohn David und ich. Endlich – Familie. David wiegt inzwischen 1000 Gramm, er atmet mit Sauerstoffbrille. Nick schaut mich an – und macht mir einen Heiratsantrag. Wir haben es bis hierhin geschafft, was soll uns nun denn noch trennen? Ich sage ja.
Am 16. Dezember 2011, neun Tage vor dem errechneten Geburtstermin, nehmen wir unser Kind voll sondiert und mit einem Überwachungsmonitor mit nach Hause.
Von Normalität sind wir noch sehr lange und sehr weit entfernt. Es folgt eine Essstörung, die mich über ein Jahr in Atem hält und mich über meine Grenzen treibt. Noch zweimal Klinik und einmal ambulante Therapie. Nichts hilft, David isst nicht und wächst kaum. Ich füttere ihn im Schlaf; anders toleriert er keine orale Berührung. Er verweigert konsequent das Essen. Am Ende helfe ich David und mir selbst. Heute isst er, auch wenn er noch immer viel zu klein und viel zu leicht ist.
David ist heute viereinhalb Jahre alt. Er ist 94 cm groß und wiegt 10,4 Kilogramm. Er hat mit 16 Monaten begonnen zu essen, mit 26 Monaten hat er die ersten Schritte gemacht, mit dreieinhalb Jahren hat er vier Worte gesprochen, heute spricht er ganze Sätze. Er geht in den Kindergarten und er liebt Polizei, Feuerwehr und Schokoeis. Wenn man ihn laufen sieht, ahnt man, dass er eine Geschichte hat, seine Motorik ist stark entwicklungsverzögert. Aber wenn man ihn nicht kennt und er dann den Mund aufmacht, dann staunt man über diese kleine wundervolle Persönlichkeit. Kognitiv ist David fast altersgerecht entwickelt. Im Mai 2013 hat David einen kleinen Bruder bekommen. Noam ist sein bester Freund und seine wichtigste Entwicklungsunterstützung in allen Bereichen. Seinen Geburtsbericht schreibe ich als Fortsetzung.


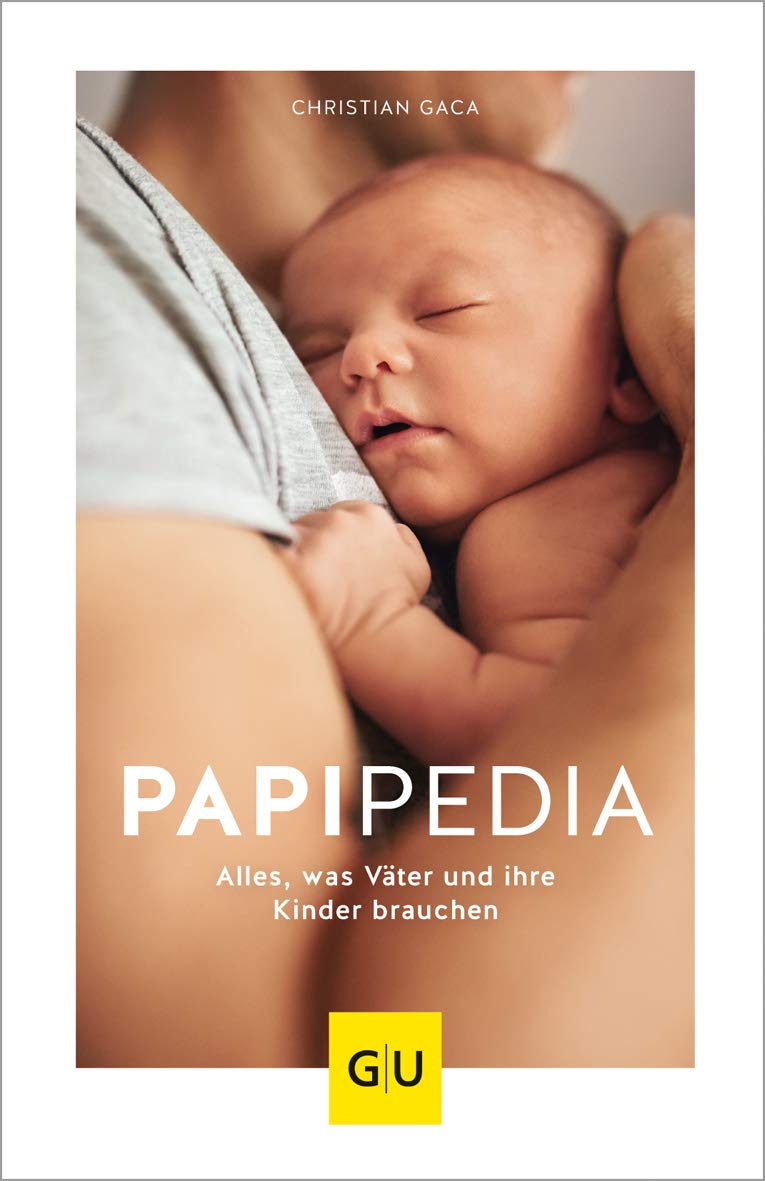





Schreibe einen Kommentar