Stillende werden von vielen Seiten mit vermeintlich guten Tipps versorgt. Nicht immer sind diese hilfreich- ganz im Gegenteil. Hier erfährst du die Hintergründe zu den bekanntesten „Milchmärchen“.
Milchmärchen 1: Sprudelwasser macht Sprudelmilch
Die Kohlensäure in Sprudelwasser soll angeblich beim Baby Blähungen verursachen und deshalb gemieden werden. Neben dem Sprudelwasserverbot gibt es noch eine lange Liste an zu vermeidenden Lebensmitteln wie Zwiebeln, Knoblauch, Kohl, Broccoli, Tomaten, Lauch und Orangensaft und so weiter. Weil diese beim Baby wahlweise zu Blähungen oder zu einem wunden Po führen würden. In der Realität ist es aber anders. Blähungen, also Darmgase, entstehen durch die Verdauung von Ballaststoffen mittels entsprechender Darmbakterien im Darm. Die Ballaststoffe und Darmgase gelangen aber nicht ins Blut. Und somit auch nicht in die Muttermilch, selbst wenn die Mutter auf ein Lebensmittel mit starken Blähungen reagiert. Und auch die Kohlesäure löst sich bereits im Magen auf und kommt nicht über das Blut in die Muttermilch.
Ja, es gibt einige Kinder, die trotz dieser Erkenntnisse empfindlich reagieren, wenn ihre Mutter bestimmte Lebensmittel gegessen hat. Am ehesten sind das solche, die bei ihr selbst zu Blähungen führen. Meist lassen sich hier aber Ursache und Wirkung sicher nachweisen. Aber etwas wegzulassen, was man als Stillende selbst nicht verträgt, ist vertretbar.
Aber die meisten Kinder haben keine Beschwerden und deshalb ist eine prophylaktische Enthaltsamkeit absoluter Unsinn. Im Gegenteil kann sie dazu führen, dass Mütter sich zu einseitig ernähren. Oder dass sie kürzer stillen, weil sie nicht zu lange auf Zwiebeln und Erdbeeren verzichten möchten.
Einzig und allein für Kuhmilch wurde nachgewiesen, dass ein kleiner Anteil der „Kolikkinder“ eine Unverträglichkeit auf das in die Muttermilch daraus übergegangene Fremdeiweiß haben. Da kann in Absprache mit Hebamme, Kinderarzt oder Stillberaterin getestet werden, ob das Weglassen von Kuhmilchprodukten eine Besserung bringt. Überdiagnosen kommen hier häufiger vor. Ein prophylaktisches Vermeiden nicht sinnvoll. Mütter machen sich damit nur unnötig das Leben schwer. Eine „Stilldiät“ und der Verzicht auf diverse gesunde sowie leckere Lebensmittel ist auch schwer mit der Empfehlung zu vereinbaren, dass Stillende sich vollwertig und ausgewogen ernähren sollten.
Milchmärchen 2: Viel essen macht viel Milch
Wenn man weltweit über den Tellerrand schaut, wird sogar manchen unserer „NoGo“-Lebensmittel in der Stillzeit wie dem Knoblauch in anderen Ländern ein milchbildungsfördernder Effekt nachgesagt. Und mehr pupsen die Kinder dort auch nicht. Aber Ammenmärchen halten sich nun mal hartnäckig. Und so hören noch viele Frauen bei nicht ausreichender Milchbildung die Empfehlung, einfach reichlich zu essen und literweise Stilltee zu trinken, anstatt das Stillmanagement zu optimieren. Die Milchproduktion wird nicht durch Stilltee und Gerstenbrei angeregt, sondern in erster Linie durch häufiges und korrektes Anlegen des Kindes. Die Teepause kann wohltuend im Stillalltag sein, aber ist keine Strategie bei Gedeihstörungen. Hole dir hier zeitnah kompetente Hilfe durch deine Hebamme oder eine Stillberaterin.
Auch wenn kulturell viele Lebensmittel als milchbildend bekannt sind, ist bisher nur für Bockshornklee eine milchmengensteigernde Wirkung wirklich nachgewiesen. Allerdings auch nur in ausreichender Dosierung in Form von Bockshornkleesamenkapseln. Bei der Einnahme können Unverträglichkeiten auftreten, weswegen auch hier die Absprache mit einer Stillberaterin wichtig ist.
Es reicht also nicht aus, ein paar Bockshornkleesprossen über den Salat zu werfen. Tatsächlich haben die „Milchbildungsgerichte“ aber manchmal einen nicht zu unterschätzenden Placeboeffekt, wenn die Mütter von der Wirkung überzeugt sind.
Wenn allerdings nicht parallel die Milchbildung ausreichend stimuliert wird, werden sie auch kein Wunder bewirken. Deshalb brauchen sich Frauen, die vielleicht phasenweise etwas appetitlos nach der Geburt sind, keinen Kopf machen, dass deshalb sofort ihre Muttermilchbildung nicht mehr ausreicht. Allerdings werden so ihre körperlichen Reserven schnell erschöpft sein und das ist keine gute Basis für den anstrengenden Babyalltag.
Milchmärchen 3: Stillende müssen ganz viel trinken
Stillende sollten generell nach ihrem Durstgefühl trinken. Und sich am besten zu jedem Stillen etwas zu trinken hinstellen. Denn die Oxytocinausschüttung erzeugt Durst. Eine zu hohe Flüssigkeitsaufnahme (mehr als die in der Stillzeit empfohlenen zwei bis drei Liter) führt sogar zu weniger Milch. Trinkt eine Frau während der Stillzeit weit über ihr Durstgefühl hinaus, deaktiviert dies das Antidiuretische Hormon (ADH). Der Körper schwemmt als Resultat viel Wasser aus. Und das wiederum wirkt milchbildungshemmend.
Milchmärchen 4: Kaffee hält die Babys wach
Ein, zwei Tassen Kaffee oder schwarzer Tee sind in der Regel kein Problem. Wenn ein Baby tatsächlich auf das Koffein mit vermehrter Unruhe reagiert, ist es ratsam, den Koffeinkonsum zu reduzieren. Allerdings dauert es bis zu über 80 Stunden, bis sich beim Neugeborenen das Koffein abgebaut hat. Der Grund: Die Eliminationshalbwertzeit ist deutlich erhöht. Dies liegt daran, dass die kindliche Leber noch unreif ist. Koffein ist auch in anderen Getränken, Lebensmitteln und auch in Medikamenten vorhanden. Aber auch beim Kaffee gilt: Einfach ausprobieren – viele Babys sind völlig unbeeindruckt vom moderaten Kaffeekonsum der Mutter.
Milchmärchen 5: Alkohol regt die Milchbildung an
Wenn das Stillen nicht so rund läuft, kommt gerne der schlaue Tipp, die Mutter soll sich nur mal richtig locker machen. Ein Gläschen Sekt oder Wein rege zudem noch die Milchbildung an. Das Gegenteil ist der Fall. Alkohol hemmt den Milchspendereflex. Studien belegen, dass Kinder weniger trinken, wenn die Muttermilch Alkohol enthält. Denn Alkohol verändert den Geruch und den Geschmack der Muttermilch. Alkohol geht fast in gleichem Maße wie in das Blut der Mutter in ihre Milch über.
Milchmärchen 6: Sahne futtern steigert den Fettgehalt der Milch
Sahne und Butter sind „Nervenfutter“ – steigern aber nicht den Fettgehalt der Milch. Kalorien-, Fett-, Eiweiß- und Laktosemenge und bestimmte Nährstoffe wie z.B. Eisen oder Folsäure können nicht durch die Nahrung der Mutter beeinflusst werden. Folgende Nährstoffe können aber durch die Ernährung in der Stillzeit beeinflusst werden: die Vitamine A, C, B1, B2, B6, B12, D, Niacin und wahrscheinlich Vitamin K sowie die Zusammensetzung (nicht die Fettmenge!) der Fettsäuren. Darum ist die Verwendung hochwertiger Fette (z.B. Omega3-Fette) sinnvoll. Aber bevor alle Stillenden jetzt anfangen, Nährstoffe zu zählen – eine meistens vollwertige, ausgewogene Ernährung wird das alles abdecken. Für bestimmte Ernährungsformen ist aber eventuell z.B. eine Vitamin B12-Supplementation erforderlich. Aber da empfiehlt sich immer eine persönliche und individuelle Beratung und kein angelesenes Internetwissen.
Milchmärchen 7: Stillende müssen für zwei essen
Schwangere wissen hoffentlich mittlerweile alle, dass sie nicht für zwei essen müssen. Genauso gilt dies für die Stillzeit. Der Kalorienbedarf in der Schwangerschaft ist um ca. 300 bis 600 Kilokalorien erhöht, diese lassen sich aber durch ein, zwei kleine Zwischenmahlzeiten decken. Genau wie in der Schwangerschaft ist aber der Bedarf an einigen Nährstoffen erhöht. Darunter sind Proteine, Vitamin A, B, und E sowie Folsäure, Magnesium, Jod und Zink. Daher empfehlen sich Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte. Der Körper greift bei schlechter Versorgung auf die mütterlichen Reserven zurück. So bleibt die Qualität der Muttermilch gleichbleibend gut, aber die Mutter würde den Mangel spüren. Wer sich da Sorgen macht, dem lege ich auch eine Beratung zur individuellen Ernährungssituation ans Herz. Das ist besser, als unkontrolliert Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken.
Milchmärchen 8: In der Stillzeit darf man nicht abnehmen
Der Körper legt in der Schwangerschaft natürliche Reserven für die Stillzeit an. Bei unserem großen Nahrungsangebot werden diese nicht mehr unbedingt benötigt. Und so gibt es neben den Frauen, die in der Stillzeit aufpassen müssen, nicht zu dünn zu werden, auch viele Frauen, die mit den restlichen Schwangerschaftspfunden „kämpfen“. Übergewicht und seine Folgen wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, gewisse Krebsarten et cetera sind mit die größten gesundheitlichen Probleme des 21. Jahrhunderts.
Um diese Risiken zu senken ist es sinnvoll, das Vorschwangerschaftsgewicht in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten nach der Geburt wieder zu erlangen. Am besten geschieht das durch eine Kombination von Stillen, Sport und einer ausgewogenen Ernährung. Die Stillzeit mit ihrem erhöhten Kalorienbedarf ist eine ideale Zeit, um Gewicht zu verlieren, denn der Körper hat ein natürliches Bestreben, sein Vorschwangerschaftsgewicht zu erreichen. Schwangere und junge Eltern sind außerdem in dieser Lebensphase meist sehr an einer gesunden und ausgewogenen Ernährung interessiert.
Werden folgende Punkte beachtet, wird eine längerfristige Diät die Milchmenge nicht beeinflussen:
- die Mutter ist nicht untergewichtig und das Kind ist nach Bedarf gestillt
- die Gewichtsabnahme sollte nicht mehr als zwei Kilogramm im Monat betragen
- die Diät darf nie einseitig sein (z.B. Ananas-Diät) und die Kalorienaufnahme sollte maximal 500 kcal unter dem tatsächlichen Bedarf liegen, so ist bei einer ausgewogenen Ernährung kein Nährstoffmangel zu befürchten.
- Wer also die Stillzeit zur moderaten Gewichtsreduktion nutzen will, kann das tun und sich auch gerne hier noch mal entsprechend beraten lassen.




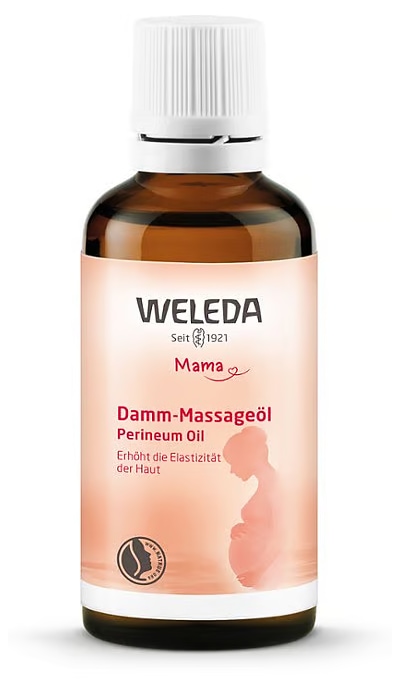






Schreibe einen Kommentar