Der errechnete Termin, kurz ET oder EGT genannt, ist ein Datum, um das sich die Schwangerschaft von Anfang an dreht. Werdenden Eltern wird zum Beispiel anhand des ET ihr tägliches Entwicklungsupdate in Schwangerschaftsapps angezeigt. Das Datum ist maßgeblich für Anträge und Schutzfristen.
Doch wie verlässlich dieser Termin eigentlich in Bezug auf den Geburtstag des Babys? Sagt er, wann die Geburt los geht? Dies erfährst du in diesem Beitrag. Außerdem bekommst du einige Tipps und Anregungen, um möglichst gelassen mit der Warteschleife vor der Geburt umzugehen.
Auch wenn es anders klingt: Der errechnete Termin stimmt nur selten mit dem wirklichen Geburtsdatum deines Babys überein. Nur rund vier Prozent aller Kinder kommen am ET zur Welt. Die Formel zur Berechnung des Geburtstermin ist auf den Gynäkologen Franz Naegele zurückzuführen.
Den ET berechnen
Bestimmt wird dieses Datum durch eine Rechenregel, die sich am ersten Tag der letzten Regelblutung orientiert. Zu diesem Tag werden sieben Tage hinzuaddiert und drei Monate abgezogen. Dazu rechnet man wiederum ein Jahr dazu. Fertig ist der ET. Naegeles Geburt fand übrigens 1778 statt. Seine Entwicklung der Rechenformel beruht auf den Annahmen zur Schwangerschaftsdauer von Herrmann Boerhaave, der von 1668 bis 1737 lebte. Die über 200 Jahre alte Naegelsche Regel als Berechnungsgrundlage für den Geburtstermin basiert auf Grundannahmen zum weiblichen Zyklus, die nicht mehr dem aktuellen Stand der Forschung entsprechen.
Das Wissen über den weiblichen Zyklus und die Dauer der Schwangerschaft ist heute um einiges umfangreicher. Doch noch immer ermitteln wir den ET auf Basis der uralten Formel. Hinzu kommen weitere Faktoren, die den ET zusätzlich unzuverlässig machen. Manche Schwangeren können nicht verlässlich den Tag ihrer letzten Periode angeben. Oder es wird vergessen nachzufragen, ob der Zyklus länger oder kürzer ist.
Unregelmäßige Regel
In den Geburtsterminrechnern ist dafür in der Regel gar kein Eingabefeld vorgesehen. Dies führt also zu anderen Ergebnissen als dem „Geburtshilfelehrbuchzyklus“ von 28 Tagen. Genauso findet der Eisprung nicht immer in der Zyklusmitte statt. Gerade die erste Zyklushälfte ist in ihrer Länge zeitlich sehr variabel. Das erhöht die Ungenauigkeit des ET. Die Regel ist oftmals alles andere als regelmäßig, wenn auch alles trotzdem meist im Bereich des Normalen liegt.
Via Frühultraschall lässt sich der ET zwar recht genau einkreisen. Aber auch durch das Messen der Scheitel-Steißlänge des Embryos lässt sich der ET „nur“ bei 95 Prozent der Schwangeren auf plusminus fünf Tage festlegen. Präzise ist anders.
Sehr relevant ist das alles bei einer möglichen Terminüberschreitung. Dann sind fünf Tage mehr oder weniger absolut entscheidend, um eventuellen zu frühen Einleitungsmaßnahmen zu entgehen.
Geburtszeitraum statt Geburtstag
Der ET scheint also kein besonders verlässliches Datum zu sein. Trotzdem kreisen besonders zum Ende der Schwangerschaft Eltern, Angehörige und auch die Geburtshelfer sehr um diesen Termin. Wesentlich entlastender ist es stattdessen, den errechneten Geburtszeitraum anzugeben.
Der Zeitraum, in dem die meisten Babys zur Welt kommen, sind die drei Wochen vor und die zwei Wochen nach dem errechneten Termin. Dann gelten Kinder nicht mehr als frühgeboren bzw. spricht man erst 14 Tage nach dem ET tatsächlich von einer Übertragung. Davor wäre die „Überschreitung des errechneten Geburtstermines“ die korrekte Bezeichnung. Wie lange eine Schwangerschaft im Durchschnitt dauert, erfährst du hier.
6 Tipps zum Umgang mit dem Geburtstermin
- Nervige Nachfragen vermeiden: Das Warten auf die Geburt betrifft nicht nur die Eltern. Auch werdende Großeltern, Familienmitglieder, Freunde oder Kolleg*innen sind neugierig und erwartungsvoll. Das meist nett gemeinte Nachfragen nervt aber mitunter ganz schön. Werdende Eltern sollten darum lieber großzügig einen Geburtszeitraum, einen Geburtsmonat oder vielleicht auch nur eine Jahreszeit angeben. Denn man kann als Schwangere „über ET“ noch so gelassen sein: Die ewige Fragerei führt nicht zu mehr innerer Ruhe
- Die Unplanbarkeit annehmen: Warten auf den Geburtsbeginn kann eine ganz schöne Herausforderung sein. Aber sie bereitet die werdenden Eltern auf eine Zukunft vor, in der sich auf einmal vieles nicht mehr planen lässt. Sie wird aber genauso viele schöne, überraschende und ganz unerwartete Momente bereithalten. Das Leben mit Kindern hält sich immer wieder nicht an bestimmte Termine und Erwartungen. Liebevolles Annehmen hilft auch beim Warten darauf, dass sich dein Baby seinen Geburtstag aussucht.
- Wartezeit schön gestalten: Du hast so viele Monate gewartet. Jetzt geht es nur noch um Tage, bis du dein Baby in den Armen hältst. Überlege dir, was du und dein:e Partner:in noch Schönes unternehmen könntet. Was wird vielleicht erst mal nicht mehr so einfach möglich sein: ein Nachmittag im Kino oder ein entspannter Restaurantbesuch? Suche dir aber Unternehmungen aus, die sich leicht und kurzfristig absagen lassen können. Und deren Ort nicht allzu weit von deinem gewünschten Geburtsort entfernt ist. Wenn es schon Kinder gibt, kann man noch mal ganz bewusst Exklusivzeit genießen, bevor ein weiteres Kind elterliche Ressourcen beansprucht.
- Kraft sammeln: Fühle in dich hinein, wer und was dir jetzt guttut und womit du Kraft sammeln kannst: ein gutes Essen, ein Mittagsschlaf oder ein Spaziergang im Park. Nutze die Wartezeit, um Kraft für die anstehende Geburt zu sammeln. Vielleicht gibt es auch noch ein ToDo wie das Ausfüllen des Elterngeldantrages was Du gerne erledigt hättest. Geh das an, wenn es dir hilft den Kopf freizubekommen.
- Körperliche Zeichen nicht überinterpretieren: Im Geburtszeitraum horchen Schwangere noch mal mehr in sich hinein, ob nicht dieses oder jenes Ziehen der Geburtsbeginn sein könnte. Die Appetitlosigkeit oder der schlechte Schlaf könnten vielleicht darauf hinweisen. Und dann kommen noch die geburtshilflichen Expert*innen, die aufgrund von Gesichtsfarbe, Stuhlgang und Cervixbeschaffenheit orakeln, dass das Kind ja sehr wahrscheinlich dann und dann käme. Doch keine Hebamme, keine Ärztin und keine Nachbarin kann das vorhersagen. Auch vaginale Untersuchungen haben keine oder nur eine begrenzte Aussagekraft. So könnten Befunde am Ende der Schwangerschaft, wenn sich zum Beispiel alles „schön weich, verkürzt und geburtsbereit“ tastet, darauf hinweisen, dass es bald losgeht. Aber letztendlich kann die Frau mit dem „nicht so geburtsreifen Befund“ ihr Baby viel eher im Arm halten. Vaginale Untersuchungen sind hier also nicht nötig. Im Gegenteil: Sie sind immer ein intimer Eingriff und können das Infektionsrisiko erhöhen. Es gilt also, wie bei jeder Untersuchung, Nutzen und Risiken sorgfältig abzuwägen. Wenn du körperliche Symptome nicht gut einschätzen kannst oder sie Dir Sorgen machen, wende Dich gerne mit Fragen an deine Hebamme oder Gynäkologin.
- Geburtseinleitende Maßnahmen abwägen: Warten kann ganz schön herausfordernd sein. Wie verlockend ist da der Gedanke, die Geburt ein bisschen anzuschubsen. Aber die ganzen Hausmittelchen wirken eh nur, wenn der Körper ohnehin geburtsbereit ist. Sonst kann man auch literweise „wehenfördernde“ Tees trinken. Auch das im Sperma enthaltende Prostaglandin ist mengenmäßig bei weitem nicht ausreichend, um eine Geburt wirklich einzuleiten. Sex am Termin ist also nur zu empfehlen, wenn beide Lust dazu haben – und das ist der einzige Grund. Einleitungsmaßnahmen wie Wehencocktails oder Nelkenöltampons sind definitiv keine Selbsthilfemittelchen für den Hausgebrauch, sondern sollten wenn überhaupt immer nur in Absprache mit den jeweiligen Geburtshelfern angewendet werden. Das gilt natürlich auch für alle medikamentösen Einleitungsmaßnahmen, die ohnehin nur in der Klinik stattfinden und medizinischen Indikationen vorbehalten bleiben sollten. Denn eine Einleitung ist kein Spaziergang. Wann und weshalb eine Geburtseinleitung erforderlich sein kann, erfährst du in diesem Beitrag.







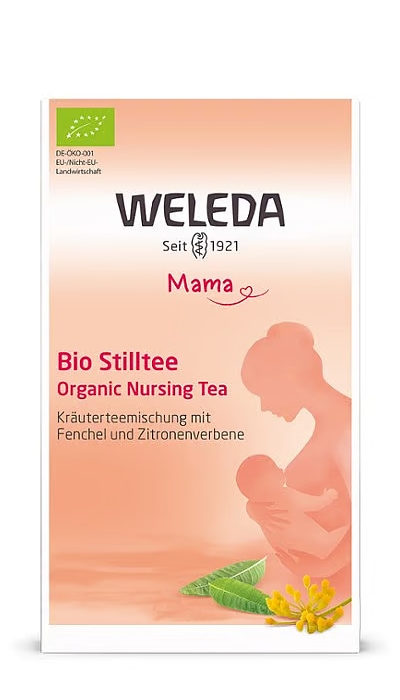



Schreibe einen Kommentar